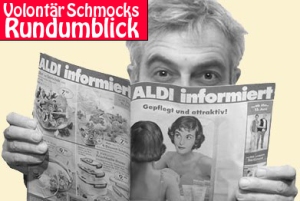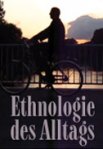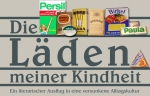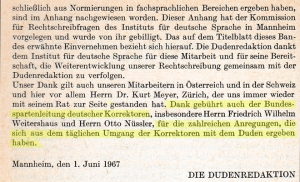Mein in Leipzig lebender Sohn teilte mir am Telefon mit, „postfaktisch“ sei Internationales Wort des Jahres geworden. Ich hatte keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Trotzdem steht seine Aussage im Konjunktiv I, einer sogenannten „Distanzform.“ Es gibt im Deutschen deren vier insgesamt. Mit einer Distanzform zeigen wir an, dass wir die Aussage eines anderen zitieren. Da mein Sohn mir keine Quelle genannt hat, habe ich ein wenig recherchiert. Spiegel.de meldete hier: „Die britische Wörterbuchreihe Oxford Dictionaries hat am Mittwoch auf ihrer Webseite ihr internationales Wort des Jahres bekannt gegeben. Es handelt sich um den Begriff „post-truth“, auf Deutsch übersetzt mit ‚postfaktisch‘.“ Und weiter: „Oxford Dictionaries definieren den Begriff als Beschreibung von „Umständen, in denen objektive Fakten weniger Einfluss auf die Bildung der öffentlichen Meinung haben als Bezüge zu Gefühlen und persönlichem Glauben.“
Mein in Leipzig lebender Sohn teilte mir am Telefon mit, „postfaktisch“ sei Internationales Wort des Jahres geworden. Ich hatte keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Trotzdem steht seine Aussage im Konjunktiv I, einer sogenannten „Distanzform.“ Es gibt im Deutschen deren vier insgesamt. Mit einer Distanzform zeigen wir an, dass wir die Aussage eines anderen zitieren. Da mein Sohn mir keine Quelle genannt hat, habe ich ein wenig recherchiert. Spiegel.de meldete hier: „Die britische Wörterbuchreihe Oxford Dictionaries hat am Mittwoch auf ihrer Webseite ihr internationales Wort des Jahres bekannt gegeben. Es handelt sich um den Begriff „post-truth“, auf Deutsch übersetzt mit ‚postfaktisch‘.“ Und weiter: „Oxford Dictionaries definieren den Begriff als Beschreibung von „Umständen, in denen objektive Fakten weniger Einfluss auf die Bildung der öffentlichen Meinung haben als Bezüge zu Gefühlen und persönlichem Glauben.“
Das ist die hübsch einseitige Definition von „postfaktisch“, die sowohl unseren Medien gefällt als auch Politikern wie Frau Merkel. Um dahinter zu kommen, was daran grundsätzlich zu kritisieren ist, sehen wir uns an, was „faktisch“ bedeutet oder genauer, was ein Faktum ist. Das aus dem Lateinischen entlehnte Wort meint „etwas Tatsächliches, Verifiziertes.“ Verifizierung (von lat. veritas ‚Wahrheit‘) ist der Nachweis, dass ein vermuteter oder behaupteter Sachverhalt wahr ist.
Wir kennen aus dem Alltag Tatsachen unserer physikalischen Wirklichkeit. Ans Fenster prasselt der Regen. Ich öffne es, sehe hinaus, werde nass, und habe die audiovisuellen Wahrnehmungen um eine haptische ergänzt, womit die Beobachtung mit allen Sinnen überprüft wäre und somit die faktische Feststellung ist, dass es regnet. Angenommen, mein Sohn teilt mir am Telefon mit, dass es in Leipzig stark regnet, und ich traue ihm, obwohl ich nicht selbst verifizieren kann, ist auch seine Mitteilung für mich faktisch. Wenn am nächsten Tag in der Zeitung stünde, dass für Leipzig weiterer Starkregen angekündigt sei, dann würde ich für eine geplante Reise nach Leipzig einen Schirm mitnehmen, denn der Wetterbericht ist eine Nachricht im etymologischen Wortsinne: Nachricht = „Wonach man sich zu richten hat.“
Der Mensch richtet sich nach dem selbst Erlebten und nach den Berichten, denen ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit zukommt. Wer den Wetterbericht verwerfen würde und deshalb ohne Schirm in einen Starkregen geriete, verhielte sich im oben definierten Wortsinne postfaktisch. Aber wer tut das? Wohl kaum jemand.
Aber in der Definition heißt es „objektive Fakten“ hätten weniger Einfluss auf die Bildung der öffentlichen Meinung. „Objektive Fakten“ sind jene, die man durch eigenes Erleben oder durch Nachrichten vertrauenswürdiger Personen gewinnt. Ob es regnet oder nicht, ist ein einfacher Sachverhalt. Was aber beispielsweise auf einem entfernten Kriegsschauplatz geschieht, und wie das Geschehen zu bewerten ist, ist hochkomplex. Dem kalifornischen Senator (von 1917-1945) Hiram Warren Johnson wird das geflügelte Wort zugeschrieben: „Das erste Opfer eines jeden Krieges ist die Wahrheit.“ Es ist also klug, allen Berichten, die uns medial aus einem Kriegsgebiet erreichen, zu misstrauen. Dieses Misstrauen hat sich ausgedehnt auf viele Bereiche, nicht zuletzt, weil uns durch das Internet inzwischen andere Quellen als die TV-Nachrichten oder Zeitungen zur Verfügung stehen, etwa Augenzeugenberichte aus aller Welt. Die klingen manchmal anders als das, was in der Zeitung steht. Doch die Skepsis gegenüber Zeitungen ist keine junge Erscheinung. Der amerikanische Journalist und Schriftsteller Ambrose Bierce (1842 – 1914) höhnte schon Anfang des 20. Jahrhunderts in seinem sarkastischen Wörterbuch: The Devil’s Dictionary
„Erfrischend: Einen Menschen treffen, der alles glaubt, was in den Zeitungen steht.“
Derart erfrischend naive Menschen sind selten geworden. Doch verleugnen die weniger Naiven die Fakten? Laufen sie vor den Bus, weil der Automobilverkehr nicht in ihr Weltbild passt? Natürlich gibt es Eiferer, die sogar das Offensichtliche leugnen.

postfaktisch im Duden – Scan und Schriftmontage JVDL (größer: Bitte klicken)
Doch in der Regel ist Misstrauen gegenüber jeder Information aus zweiter und dritter Hand angebracht, sogar vernünftig. Das Modewort „postfaktisch“ stellt die Verhältnisse auf den Kopf. Medien und Politik schieben ihren Glaubwürdigkeitsverlust den Leuten in die Schuhe. Spiegel.de wundert sich, dass der Duden das Wort noch nicht in die Wortliste aufgenommen hat. Abgesehen davon, dass ein Wort nicht wichtig ist, weil es prämiert wurde wie eine Thüringer Wurst, hätte ich einen Vorschlag, wie der Duden das Wort verzeichnen und erklären sollte. Zu sehen links – ein fake, denn der Duden verzeichnet kein Dummdeutsch.
 Keine Hand dem Patienten! Mit einer ähnlich lautenden Empfehlung seiner Standesorganisation begründete letztens ein mir bis dato unbekannter Orthopäde, dass er mir den Handschlag verweigerte. Ich war so befremdet, dass ich beim Abschied nachfragte, weil ich nicht mehr wusste, ob er die Ärztekammer oder die Kassenärztliche Vereinigung als Quelle genannt hatte. „Ja, ja, lieber keine Hand geben“, wiederholte er. Gestern erzählte ich das meiner Hausärztin, nachdem sie mir wie gewohnt die Hand gereicht hatte. Sie sagte: „Die Hand des Arztes ist natürlich das perfekte Übertragungsmedium, aber nicht, wenn man sie regelmäßig desinfiziert.“
Keine Hand dem Patienten! Mit einer ähnlich lautenden Empfehlung seiner Standesorganisation begründete letztens ein mir bis dato unbekannter Orthopäde, dass er mir den Handschlag verweigerte. Ich war so befremdet, dass ich beim Abschied nachfragte, weil ich nicht mehr wusste, ob er die Ärztekammer oder die Kassenärztliche Vereinigung als Quelle genannt hatte. „Ja, ja, lieber keine Hand geben“, wiederholte er. Gestern erzählte ich das meiner Hausärztin, nachdem sie mir wie gewohnt die Hand gereicht hatte. Sie sagte: „Die Hand des Arztes ist natürlich das perfekte Übertragungsmedium, aber nicht, wenn man sie regelmäßig desinfiziert.“