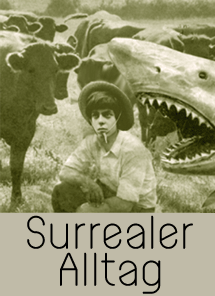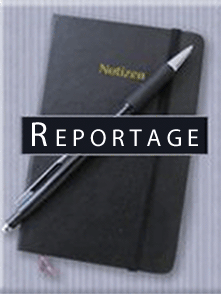 Die bahn folgt einer gesichtslosen straße durch Ricklingen. Lediglich in der nähe des ricklinger bürgeramts erkenne ich das fotostudio, wo ich mir mal unter zeitdruck habe passbilder machen lassen. Der fotograf öffnete erst 9:30 uhr, und um 10 hatte ich im bürgeramt einen online gebuchten termin zur personalausweisverlängerung. Es war der einzige, den ich hatte bekommen können. Weitere termine gab es bei allen städtischen bürgerämtern hannovers erst in ferner zukunft. Da waren zwei dicke frauen vor mir gewesen, und derweil sie sich für die fotos in szene setzten, saß ich auf heißen kohlen. Beim bürgeramt biegt die strecke fast 90 grad ab, vorbei am stadtfriedhof Ricklingen.
Die bahn folgt einer gesichtslosen straße durch Ricklingen. Lediglich in der nähe des ricklinger bürgeramts erkenne ich das fotostudio, wo ich mir mal unter zeitdruck habe passbilder machen lassen. Der fotograf öffnete erst 9:30 uhr, und um 10 hatte ich im bürgeramt einen online gebuchten termin zur personalausweisverlängerung. Es war der einzige, den ich hatte bekommen können. Weitere termine gab es bei allen städtischen bürgerämtern hannovers erst in ferner zukunft. Da waren zwei dicke frauen vor mir gewesen, und derweil sie sich für die fotos in szene setzten, saß ich auf heißen kohlen. Beim bürgeramt biegt die strecke fast 90 grad ab, vorbei am stadtfriedhof Ricklingen.
Dahinter passend eine seniorenresidenz. Ein stattlicher industriekomplex hat auf einer giebelfront die aufschrift „GROSSDRUCKEREI PETERSEN“, ein relikt aus den 1970-er jahren. Das unternehmen ist verschwunden. Heute taugt das dach gerade mal für photovoltaik. In einer solchen großdruckerei habe ich 1967 meine praktische gesellenprüfung als schriftsetzer gemacht, ohne zu ahnen, dass mein handwerk fünf jahre später museal sein würde. Ich glaube, die Neußer großdruckerei hieß Wengener. Man hatte eigene lehrlinge, und die sollten gewiss besser abschneiden als externe wie ich. Für die prüfung im schnellsatz stellte man mir in einem abgelegenen Winkel des setzereisaals einen völlig verfischten kasten auf. Fische (auch zwiebelfische) nannte der schriftsetzer falsch abgelegte lettern. Besonders ärgerlich sind fische aus anderen schriften. Man erkennt sie nicht am anderen schuppenkleid, sondern an der abweichenden signatur, also an der kerbe an der vorderseite der letter und muss sie immer wieder aus gesetzten zeilen herausangeln. Als ich in dieser mittelalterlichen technik geprüft wurde, gab es schon maschinensatz und auch ansätze von computergestütztem fotosatz, wodurch handsatz großer mengen längst überflüssig war. Ich war also bereits unwissentlich aus der zeit gefallen.
Ein auszubildender heutiger zeit ist eingestiegen und erzählt einer jungen frau gegenüber von seinen prüfungsvorbereitungen. Was er lernt, kann ich nicht hören. Aber seinen reden ist zu entnehmen, dass er in der firma seines onkels arbeitet. Der ruft an, und ich höre eine sonore stimme, die weitschweifig erklärungen abgibt. „Das problem ist, mein onkel redet viel, sagt ‚wir müssen gas geben‘ und sowas, aber das passiert nie“, sagt der lehrling, nachdem das telefongespräch beendet ist. Da wäre er vielleicht bei Heinos „Onkel Werner in der werkstatt“ besser aufgehoben.
Ich bewundere die junge frau. Sie hört dem lehrling freundlich zu, wendet verständiges ein, fragt einiges nach, etwa wie alt der onkel sei. Er kann es auf seinem Smartphone nachgucken: „40“. Umgekehrt fragt er sie nichts. Woran liegt es, dass manche menschen, frauen zumeist, sich immer so einseitige kommunikation auf den hals laden? Als ich noch keine probleme hatte, vom boden aufzustehen, saß ich gerne beim sonnenuntergang auf der dornröschenbrücke. Da hörte ich eine junge frau sagen: „Der Philipp ist so nett. Kann er nicht mal sein gegenteil finden?“ Ich musste schmunzeln. Ihr gegenteil finden nette menschen rasch, passende gegenstücke leider fast nie. Wieder ändert die linie 13 ihre richtung, biegt jetzt auf die Göttinger Chaussee ein, durchquert Hemmingen, und bald ist die endhaltestelle erreicht.
Ein mann und seine alte graue mutter haben sich auch aus neugier hinfahren lassen und steigen mit mir aus. Die mutter schaut sich aufmerksam um, und aus mangel an anderem lobt sie den großzügig angelegten parkplatz nebenan. „Park + Ride“, sagt der sohn. Ob die mutter weiß, was das ist? Ich jedenfalls habe das verkehrspolitisch fragwürdige konzept nie verstanden. Statt ausgedehnter flächenversiegelung hätte man bei den neu angelegte bahnsteigen wenigstens einen kiosk planen können. So gibt es nichts, was zum verweilen einlädt. Endhaltestelle und parkplatz sind klassische nichtorte, heterotopien im Foucaultchen sinne. Man sollte seine alte mutter nicht herbringen. Es könnte hier an Hemmingens ortsgrenze trotzdem schön sein, allein der ländlichen ruhe wegen. Die Göttinger Chaussee heißt schon ab Hemmingen Göttinger Landstraße.
- Das französische „Chaussee“ vermittelt mir die vorstellung von gemächlichen reisen mit der postkutsche. Die romantisierung wäre mir rasch vergangen, denn für die etwa 120 kilometer von Hemmingen bis Göttingen hätte ich mir in den gut 12 stunden bald den hintern wund gesessen. Nähmen wir lieber den überlandbus über die Göttinger Landstraße. In meiner jugend fuhren auf solchen strecken noch die gelben postbusse, an bord nicht nur fahrgäste, sondern auch postsäcke voller briefe und pakete.
Das sind müßige ideen vom gefahren werden. Es wird jetzt „gewandert“! Mein ziel und den weg dorthin habe ich mir bei google maps bereits angesehen. Ich schultere meinen rucksack und tippele los.
Wird fortgesetzt …