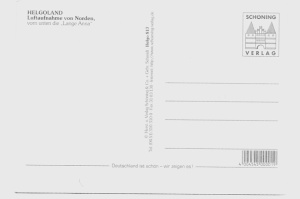 (Im Bild: Helgoland von der schönsten Seite)
(Im Bild: Helgoland von der schönsten Seite)
„Wer einmal auf Helgoland war, kommt immer wieder!“, schwärmte die Frau. Lisette und ich saßen mit einem älteren Ehepaar aus Berlin am Tisch einer im Wellengang mächtig schaukelnden Hochseefähre. Sie erzählten davon, seit Jahren schon Silvester auf Helgoland zu verbringen. „Ach!“, sagte Lisette ungläubig. Ich sehe noch heute ihren erstaunten Blick, als hätte sie jetzt erst realisiert, wo wir eine Woche gewesen waren. Etwa auf Helgoland? Jedenfalls hatte sie wohl eigentlich Rügen gemeint, wo sie mal hingewollt hatte, und ich wäre im Leben nicht nach Helgoland geschippert, wenn sie nicht den Wunsch geäußert hätte, Silvester auf Helgoland zu verbringen. Helgoland und Rügen kann mal schon mal verwechseln. Aaaber werden jetzt die Oberschlauen sagen: Rügen liegt in der Ostsee und Helgoland in der Nordsee. Na und, würde Lisette entgegnen, sind jedenfalls beides Inseln. Und außerdem glaubte sie, mir einen Wunsch zu erfüllen. Dabei kann ich fast beschwören, das Wort Helgoland nie in den Mund genommen zu haben. Höchstens als wir mal zusammen auf der ostfriesischen Insel Baltrum waren. Da gibt es einen Landeplatz für den Inselflieger. Kleine Inseln habe ja alle etwas Langweiliges. Da ist so ein Flieger, der von einer langweiligen Insel zur nächsten hoppst, ein wenig verlockend. Damals könnte ich gesagt haben, derweil ich den Flugplan studierte: „Ach, guck, der fliegt auch nach Helgoland!“
Helgoland hat im Winter jedenfalls den Charme einer belgischen Kaserne, wenn du weißt, wie trostlos belgische Kasernen aussehen, nur dass ringsum Hochsee ist, rund 50 Kilometer bis zum Festland. Es fehlen historische Gebäude, wie man sie auf den friesischen Inseln gelegentlich findet, denn nach dem 2. Weltkrieg hatte die Royal Air Force Helgoland mit seinen unterirdischen Bunkeranlagen zerbomben wollen. Der etwa ein Quadratkilometer große Sandsteinfelsen hatte Stand gehalten, aber sonst lag wohl alles darnieder und wurde in den 1950-er Jahren ziemlich stillos wieder aufgebaut, da hilft auch nicht die bunte Wandfarbe, mit der man nicht spart auf Helgoland. Eines dieser schmucklosen Reihenhäuser im Unterland hatten Lisette und ich gemietet. Es war, glaube ich, blau getüncht. Mir war egal, wie Haus und Insel aussah. Mit Lisette war es überall schön. Ich war glücklich, Silvester mit ihr verbringen zu können, denn das war viele Jahre nicht möglich gewesen. Wir waren zwar beide verheiratet, aber nicht miteinander.
Die Helgoländer sind Touristen gegenüber gleichgültig, so etwa in der Haltung Ist-mir-doch-egal,-ob-du-auf-die-Insel-kommst-und-dein-Geld-herbringst. Damit sind sie schon weit freundlicher als die Friesen von Nord- und Ostseeküste, die am liebsten hätten, die Touristen würden nur ihr Geld vorbeibringen und dann gleich wieder verschwinden. Man merkt, dass die finsteren Küstenfriesen allesamt von Strandräubern abstammen. Nicht so die Helgoländer. Sie sind nur gleichgültig. Die helgoländische Gleichgültigkeit erlebten wir am Abreisetag, als die Vermieterin telefonisch nicht erreichbar war, so dass wir, um unser Geld loszuwerden, nochmal rauf mussten in die Siedlung auf dem Oberland, wo wir zunächst ebenfalls vergeblich an ihrer Haustür klingelten, weil sie offenbar keine Lust hatte aufzumachen und unsere Miete entgegenzunehmen.
Das Aufregendste an Helgoland ist der Lift vom Unterland zum Oberland. Er ist das einzige öffentliche Verkehrsmittel der Insel, aber selbstfahrend. Da ist kein Fahrstuhlführer, dem du die Knarre an den Kopf halten und befehlen kannst: „Fahren Sie mich nach Kuba!“ No, Sir. Es geht nur etwa 50 Meter senkrecht hoch.
Kurz vor dem Jahreswechsel transportierten wir jedenfalls eine Pulle Sekt und zwei Gläser mit dem Lift vom Unter- zum Oberland, liefen raus aus dem Ort zum höchsten Punkt der Insel, saßen eng beieinander im eiskalten Seewind und warteten auf das Feuerwerk. Die meisten Raketen gingen aber nicht von Helgoland hoch, die meisten zischten von See aus in den Nachthimmel. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Schiffe in der Deutschen Bucht unterwegs wären, ungesehen auch bei Tag, weil sie hinterm Horizont aus nichts als Wasser vorbeiziehen. Da oben auf der kahlen Hochebene von Helgoland, wo der Seewind ungehindert durch unsere Kleidung biss, stießen Lisette und ich aufs neue Jahr an. Damals hatte ich Hoffnung. Heute weiß ich, meine Neujahrswünsche erfüllen sich nie wie geglaubt.
Als unsere Fähre am Neujahrstag im Hafen von Cuxhaven anlegte, war es schon dunkel und es schneite. Wir fanden Lisettes alten VW-Golf total vereist vor. Er sprang aber an und brachte uns ohne Mucken zurück nach Aachen. Das kommende Jahr sah unsere Trennung. Ich begann zu bloggen, schrieb mir den Kummer vom Herzen und strandete in Hannover.
Fünf Jahre später war ich nochmals im Hafen von Cuxhaven, aber nicht mit Lisette, sondern mit Mimi. Wir wollten auch nicht nach Helgoland, sondern feierten Mimis Geburtstag in Cuxhaven. Damals war mein Leben nicht minder seltsam. Ich weiß noch, dass der Hotelier mich fragte, ob Mimi meine Sekretärin wäre. Sah ich vielleicht aus wie einer, der sich Sekretärinnen hält? Und Mimi wirkte nun wirklich nicht wie eine Sekretärin. Den Bericht von dieser ethnologischen Forschungsreise gibt es hier zu lesen.
Teestübchen Trithemius wünscht allen treuen Leserinnen und Lesern einen Guten Rutsch und ein gutes neues Jahr.












