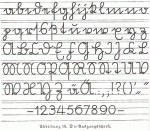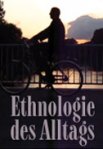Am 1. Januar 1990 um 20 Uhr hörte ich im Radio auf WDR I das Hörspiel „D’r letzte Gass“ in kölscher Mundart von Theo Rausch, das im 19. Jahrhundert angesiedelt ist. Es hat mir so gut gefallen, dass ich mich hernach hingesetzt und eine Inhaltsangabe in mein Tagebuch geschrieben habe. Das WDR-Hörspielarchiv listet das Hörspiel zwar auf, aber leider gibt es keine Tondatei. Daher kann ich zum anstehenden Jahreswechsel nur meine Aufzeichnungen bieten.
 1. Szene
1. Szene
Aufwartefrau und Stadtrat Fröschlein am Silvesterabend. Aus der Unterhaltung ergibt sich, dass Fröschlein sehr abergläubisch ist. Die Aufwartefrau näht ihm noch rasch einen Knopf an, bevor sie geht. Da fällt ihr die Schere zu Boden und bleibt mit der Spitze darin stecken. Der Stadtrat ist außer sich: Die Schere im Boden, das bedeutet späten Besuch, und ihm ist klar, wer das nur sein kann, die gestrenge Erbtante. Um ihr zu entgehen, beschließt er, in das Mattesbildchen zu gehen.
2.Szene
Im Mattesbildchen wirft der Wirt gerade den letzten Gast hinaus, einen Maurer. Der will aber noch rasch im alten Jahr reinen Tisch machen und fordert den Wirt auf, die Schröm seiner Bierdeckel zusammenzurechnen. Der Wirt fragt verwundert, ob er denn etwa seine Schulden bezahlen wolle. Daran sei kein Denken, sei er als Maurer im Winter doch zahlungsunfähig, denn: „Im Winter müsse mir Mürer uns zu zehn Mann de Fengere an enem Perdsköttel wärme!“ (Im Winter müssen wir Maurer uns zu zehnt die Finger an einem Pferdeapfel wärmen.)
 3. Szene
3. Szene
Der Wirt will die Kneipe schließen, denn er ist bei seinen zukünftigen Schwiegereltern eingeladen zwecks Verlobung. Gerade ist der Maurer gegangen, da kommt der Stadtrat und verkündigt leutselig, er werde Silvester mit ihm, dem Wirt feiern. Der ist ratlos, wie soll er den Herrn loswerden? Seine Bediente ist im Aufbruch begriffen und lässt sich nicht zum Bleiben überreden. Sie erzählt nur noch, dass gerade eben die zukünftige Verlobte zum Küchenfenster hineingeschaut habe und außer sich vor Zorn gewesen sei. Sie lasse ihm ausrichten, wenn er jetzt nicht unmittelbar komme, sei die Verlobung geplatzt. In seiner Not erzählt der Wirt dem Stadtrat, auf der Kneipe laste ein Fluch. Jeweils der letzte Gast am Silvesterabend müsse im kommenden Jahr sterben. Fröschlein ist entsetzt und bricht sofort auf. Gerade will der erleichterte Wirt die Kneipe abschließen, da kommt Fröschlein aber zurück und ruft: „Wat, do wills zomache? Wills de misch ömbrenge?“ Natürlich muss dafür gesorgt sein, dass nach ihm noch ein weiterer Gast die Kneipe besucht. Es werden zwei Kandidaten von der Straße hereingerufen, doch der eine hat neun Kinder, und der andere, ein Bäckerjunge, ist erst 16 Jahre alt. Da hat der Stadtrat doch zu große Gewissensbisse, beiden will er das Verhängnis nicht aufbürden. Der Wirt schlägt vor, er könne jemanden holen, der sei ohnehin so krank, dass er froh wäre, vom Tod erlöst zu werden. Er holt also den Maurer und verspricht ihm Geld. Beide amüsieren sich köstlich über den dummen Stadtrat. Der Maurer spielt ihm seine Szene vor und erhält von Fröschlein 500 Taler. Dann geht der Stadtrat, den Maurer als vermeintliches Opfer zurücklassend. Wirt und Maurer freuen sich königlich. Für beide ist die Sache gut ausgegangen.
 Letzte Szene
Letzte Szene
Kurz vor dem Silvesterläuten dringt der Stadtrat mit Gewalt in die geschlossene Kneipe ein. Er will trotz des bezahlten Geldes nicht, dass ein anderer statt seiner dem Schicksal ausgeliefert sei. Das Hörspiel endet mit einem herrlich philosophischen Schlusswort vom ihm. Ich habe es leider nicht behalten.