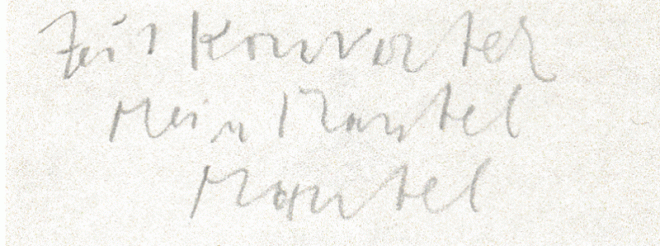Am Morgen nach dem Telefonfrevel betrat ein Herr den Verlag, der wie die vollkommene antike Ausgabe von Dyckers schien. Schnaufend begab er sich persönlich in die Setzerei und löste seinen Sohn aus. Der werde in einer Familiensache gebraucht. Hannes freute sich auf einen angenehmen Arbeitstag. Kaumanns kam in die Gasse und wies ihn an, Trauerbriefe auszuschlachten. Das war eine feine Arbeit. Hannes holte sich fünf ausgedruckte Trauerbriefe auf den Tisch und wickelte die Kolumnenschnüre ab. Zuerst sicherte er die aus Linien gebauten Kreuze, denn die konnten bei neuen Trauerbriefen wiederverwendet werden. Gestorben wird schließlich immer. Auch die Fließtexte wurden verwahrt. Sie waren formelhaft und variierten nur im Familienstatus:
- „Nach langer schwerer Krankheit verstarb heute mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, Großvater und Onkel…“
Es war Hannes, als würde in Deutschland nur so gestorben, als müsste man zuerst durch die lange schwere Krankheit hindurch wie durch eine qualvolle Ödnis am Ende des irdischen Jammertals.
 Wenn er die Texte sicher in die Holzwinkelhaken gestellt hatte, zog er die Stege heraus, das größere Blindmaterial, und sortiert sie in die Regalfächer. Nun kamen die Namen an die Reihe. Sie waren aus der 20 Punkt dreiviertelfetten Futura gesetzt, „Text.“ Hannes holte die 20 Punkt Futura aus dem Regal und wuchtet sie auf die schräge Abstelle. Alle Schriften von 16 Punkt aufwärts befanden sich in diesen schmalen Steckkästen, wo die Lettern alphabetisch geordnet aufgereiht waren. Er sammelte aus den Trauerbriefen die Namen der Verstorbenen und stellte sie hintereinander auf die Randleiste des Setzkastens.
Wenn er die Texte sicher in die Holzwinkelhaken gestellt hatte, zog er die Stege heraus, das größere Blindmaterial, und sortiert sie in die Regalfächer. Nun kamen die Namen an die Reihe. Sie waren aus der 20 Punkt dreiviertelfetten Futura gesetzt, „Text.“ Hannes holte die 20 Punkt Futura aus dem Regal und wuchtet sie auf die schräge Abstelle. Alle Schriften von 16 Punkt aufwärts befanden sich in diesen schmalen Steckkästen, wo die Lettern alphabetisch geordnet aufgereiht waren. Er sammelte aus den Trauerbriefen die Namen der Verstorbenen und stellte sie hintereinander auf die Randleiste des Setzkastens.
[Links: Steckschriftkasten, Quelle: Wikipedia]
- KatharinaKochenHerbertKnaufFerdinandOeoenHubertineSchiffer
Zuerst zog Hannes ihnen die Vokale heraus, gemäß der Abfolge der Vokalreihe, beginnend mit a, und ordnete sie am Schluss ein.
- KthrinKochenHerbertKnufFerdinndOepenHubertineSchifferaaaaa
KthrinKochnHrbrtKnufFrdinndOpnHubrtinSchiffraaaaaeeeeeeeee
KthrnKochnHrbrtKnufFrdnndOpnHubrtnSchffraaaaaeeeeeeeeeiiii
KthrnKchnHrbrtKnfFrdnndOpnHbrtnSchffraaaaaeeeeeeeeeiiiiouu
Die Vokale wurden in den Kasten eingesteckt. Nun zerlegte und sortierte er das Konsonantenskelett:
- KthrnKchmHrbrtKnfFrdnndKllnHbrtnSchff
KthrKchHrbrtKfFrddKllHbrtSchffrnnnnnnn
KthKchHbtKfKllnHbtSchffrrrrrrnnnnnnn
KhKchHbKfFddOpHbSchffrrrrrrnnnnnnnttt
KKcHKfFddOpHScffrrrrrrnnnnnnntttbbhhh
KKcHKFddOpHScfffrrrrrrnnnnnnntttbbhhh
KKHKFOpHSccfffrrrrrrnnnnnnntttbbhhhdd
KKKFOpHHSccfffrrrrrrnnnnnnntttbbhhhdd
Weg mit den Konsonanten!
Zuletzt kamen die Initialen dran:
- KKKFOHHS
Auf diese Weise begrub Hannes die Toten im Alphabet. Zufrieden betrachtete er die wohl aufgefüllten Reihen. Nun konnte man neue Namen setzen und dabei so richtig aus dem Vollen greifen. Es konnte wieder frischauf gestorben werden.
Plötzlich wurde er aus dem Alphabetspiel gerissen. Ein Mann mit einer dicken, schwarzledernen Umhängetasche betrat das Glashaus und sagte: „’n Tach!“
Hannes zuckte hoch und stotterte einen Gruß.
„Aha, da ist er ja!“ sagte der Taschenmann und schaute Hannes durchdringend an, trat auf ihn zu und ließ den Riemen von der Schulter gleiten.
„Dann wolln wir mal!“
O Schande, ein Mann von der Post! Hannes fielen alle Sünden ein, auch die Nichtbegangenen. Und er stand als Telefonsaboteur da, zumindest als Mitwisser. Es verschlug ihm den Atem.
Aber der Postmann kümmerte sich nicht weiter um ihn. Er schielte erbärmlich und hatte wohl hauptsächlich auf den Telegrafenkasten geschaut. Er beugte sich seufzend hinab, öffnete seine mit Werkzeug wohl bestückte Tasche und holte Schraubenzieher und ein Telefon zum Anklemmen hervor. Es war aus schwarzem Bakelit und bestand aus einem Hörer, in dessen unteres Ende eine Wählscheibe eingelassen war. Der Techniker öffnete den Telegrafenkasten und starrte in das Kabelgewirr. Hannes fragte sich besorgt, ob sein kreuzweis stehender Blick überhaupt in den Kasten hineinpasste, ob er also mit beiden Augen zugleich hineinsehen könnte oder nur mit einem, dem Führungsauge sozusagen, derweil das andere frei und unbenutzt umherschweifen würde, eventuell um ihn argwöhnisch zu mustern. Er wagte nicht, genau hinzuschauen, sondern schielte selbst nur aus den Augenwinkeln hinüber. Er sah den Techniker das Telefon anklemmen und eine Nummer wählen. Grußlos sprach er hinein, stocherte mit seinen Elektroschraubenzieher im Kabelgewirr herum, tauschte hier zwei Anschlüsse, fragte nach, tauschte erneut, sprach und lauschte, legte gelb an rot, blau an grün und tastete sich auf diese Weise mühsam an die ehemalige Ordnung heran. Was Dyckers in wenigen Sekunden angerichtet hatte, kostete ihn eine gute halbe Stunde. Während dieser Zeit hantiert Hannes konfus an seinem Arbeitsplatz herum, angstvoll der Fragen harrend, die nach Behebung des Schadens gewiss auf ihn zukommen werden.
Er wollte jede Mitwisserschaft ableugnen. Er nahm sich vor, dem Mann genau zwischen die Augen zu schauen, um eine Irritation beim Blickkontakt zu vermeiden. Aber hatte er sich nicht längst im höchsten Grade verdächtig gemacht? Als unbelasteter Zeuge hätte er doch Interesse zeigen müssen. So einer hätte gefragt: „Was machen Sie da?“ und neugierig in das offene Gehäuse gelugt, um sich zu wundern, wie es darin aussieht.
Der Telefonmann schraubte das Gehäuse zu. Er war mit sich zufrieden. Ich komme neuerdings viel herum, dachte er, indem er das Werkzeug verstaute. Früher war ich doch fast nur im Nordbezirk unterwegs. Und heute schon wieder ein Auftrag im Südbezirk! Ich hätte aber an die Plombenzange denken sollen! Wieso war das Ding eigentlich nicht verplombt?
Er schulterte die schwere Tasche und wollte dem Lehrling ein paar ernste Worte sagen. Doch da wurde in der Wurstküche der Motor der Kreissäge angeworfen, der Treibriemen nahm leise wimmernd seine Arbeit auf, und dann wurden Knochen gesägt, unzählige Knochen.